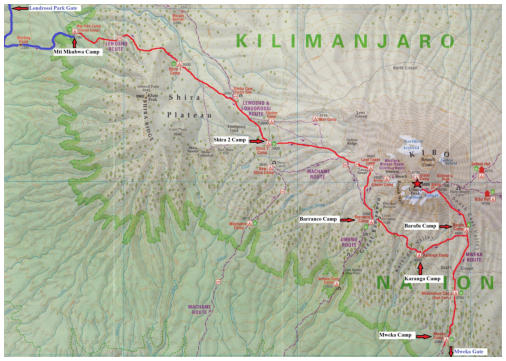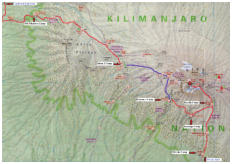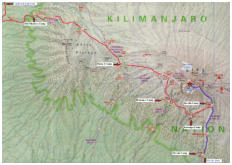GIPFELBLICKE

© Erich Arndt





Zum Seitenanfang

Zurück zur Startseite
Gipfelblicke
im Kontext der Geschichte











KILIMANDSCHARO

5.895 m
Geografie:
Der
Kilimanjaro
ist
mit
5.895 m
Höhe
über
NHN
das
höchste
Bergmassiv
Afrikas.
Es
liegt
im
Nordosten
von
Tansania.
Das
Massiv
besteht
im
Wesentlichen
aus
drei
erloschenen
Schichtvulkanen,
deren
höchster
der
Kibo
(„
der
Helle
“)
ist.
Der
Gipfel
des
Kibo
wird
Uhuru
Peak
(Freiheitsspitze)
genannt.
Unsere Aufstiegsroute:
Der
Aufstieg
führte
über
die
Lemosho-Route.
Sie
gilt
vielfach
als
die
schönste
und
ursprünglichste
aller
Kilimanjaro-Routen.
Sie
ist
noch
relativ
unbekannt
und
wird
lange
nicht
so
frequentiert
wie
die
Marangu-,
Machame-
oder
Rongai-
Route. Einzig die Umbwe-Route zählt noch weniger Bergtouristen als Lemosho.
Unsere Abstiegsroute:
Der Abstieg vom Uhuru-Peak erfolgt über den Mweka-Trail bis zum Mweka-
Camp im Regenwald.
Anstrengung:
Der
Aufstieg
auf
den
Kilimanjaro
entspricht
bis
in
eine
Höhe
von
4.500
Metern
einer
Bergwanderung
im
alpinen
Raum
unserer
Breiten.
Die
dünne
Höhenluft
und
der
sehr
steile
Anstieg
auf
der
letzten
Etappe
erfordern
jedoch
in
der
Gipfelregion eine große Anstrengung.
Ausrüstung:
Für
die
Besteigung
benötigt
man
einen
Schlafsack
mit
einem
Komfortbereich
von
-
15
°C,
eine
Isomatte,
Teleskop-/
Trekkingstöcke,
eine
Stirnlampe
und
einen
wasserdichten
Packsack.
Der
Tagesrucksack
sollte
über
eine
Regenschutzhülle
verfügen.
Hochgebirgstaugliche
Kleidung
(Handschuhe,
Goretexjacke
und
festes
Schuhwerk …) sind erforderlich.
Gefahren:
Bei
unzureichender
Ausrüstung
kann
es
zu
Erfrierungen
kommen.
Wichtig
ist
eine
ausreichende
Akklimatisation
und
Flüssigkeitsaufnahme,
um
der
Höhenkrankheit vorzubeugen ( AMS =
Acute mountain sickness
).
Letzte Aktualisierung: 01.03.2017
Eineinhalb
Stunden
vor
Mitternacht
ist
die
kurze
Nachtruhe
beendet.
Dunkelheit
und
Kälte
bestimmen
die
Nacht.
Jeder
Handgriff
kostet
Kraft.
Es
dauert
fast
eine
halbe
Stunde,
bis
die
„
Winterausrüstung
“
angelegt
und
die
restlichen
Sachen
im
Packsack
verstaut
sind.
Ein
heißer
Tee
weckt
die
Lebensgeister,
Kekse
besänftigen
den
Magen.
Sicherheitshalber,
wegen
des
Frostes,
habe
ich
die
Fotoakkus
in
der
Unterjacke
am
wärmenden
Körper
deponiert.
Um
24:00
Uhr
stehen
sechs
Menschen
im
Kreis,
halten
sich
an
den
Händen
–
Imani
spricht
ein
Gebet.
Seine
Wünsche
schließen
eine
gesunde
und
erfolgreiche
Gipfelbesteigung
ein
und
bitten
Gott
um
gütige
Unterstützung.
Der
Berg
soll
uns
wohlwollend
aufnehmen.
John,
Imani,
Dixon,
Brigitte,
Joachim
und
ich
brechen
zum
Gipfelgang
auf.
Die
letzte
Höhenzone,
die
nun
erobert
wird,
ist
die
Gipfelzone.
Sie
beginnt
ab
5.000 m
Höhe.
Geprägt
von
eisigen
Winden
und
extremen
Nachttemperaturen,
die
nicht
selten
bis
–20
°C
gehen,
ist
diese
Zone
regelrecht
lebensfeindlich
und
bietet
keinerlei
Schutz
mehr.
Das
Gesamtbild
ist
ein
einheitliches
tristes
Grau.
Hier
oben
gibt
es
keine
unterschiedlichen
Gerüche
mehr
–
die
Felsen
richen
wie
ein
alter
Komposthaufen.
Es
versteht
sich
von
selbst,
dass
auch
Tiere und Pflanzen in dieser Höhe nicht existieren können.
Es
ist
kalt.
Warmlaufen
ist
bei
dem
Schneckentempo,
das
der
Höhe
geschuldet
ist,
nicht
möglich.
Die
Lichtpunkte
der
Stirnleuchten
der
Aufsteigenden
tanzen
zwischen
den
großen
Felsblöcken.
Lichtpunkte
und
Sterne
vermischen
sich
in
der
Höhe.
Lieber
nicht
nach
oben
schauen.
Später
gibt
es
keine
Blöcke
mehr,
nur
Geröll,
Schutt,
ausgetretene
Lavaasche
mit
den
Spuren
der
Profilsohlen
vorangegangener
Leidensgenossen.
Die
Route
führt
über
Bruchstufen
von
massivem
Gestein,
die
geröllbesetzte
Unwegsamkeit
führt
immer
nur
bergauf.
Ödes
Dahintrotten.
Brigitte,
Joachim
und
Erich
kämpfen
mit
der
Luft,
die
Guides
singen
–
wie
sonderbar!
Der
Weg
bleibt
steil,
ich
spüre
die
dröhnenden
Herzschläge,
atme
bei
jedem
Schritt
ein
und
aus,
in
den
Ohren
beginnt
es
zu
sausen.
Brigitte
achtet
behutsam
auf
ihren
Herzschlag,
ist
die
Grenze
von
150
Schlägen
pro
Minute
überschritten,
legt
sie
eine
kurze
Atempause
ein.
Diese
Taktik,
die
später
von
John
gelobt
wird, verschafft uns allen kurze Erholung.
Es
sind
Wirkungen
der
Höhe.
Der
Organismus
ist
noch
zu
unangepasst,
die
roten
Blutkörperchen,
die
gebraucht
werden,
haben
sich
noch
nicht
im
ausreichenden
Maße
gebildet.
Die
Augen
tränen.
Mit
jedem
Atemzug
entzieht
die
trockene
Luft
dem
Körper
Wasser.
In
dieser
Höhe
ist
nur
etwa
ein
Zehntel
der
durchschnittlichen
Luftfeuchte
in
Meeresspiegelhöhe
vorhanden
–
und
vor
allem
lediglich
die
Hälfte
des
Sauerstoffgehalts
dort.
Schleppende
sechs
Stunden,
immer
bergauf,
das
erfordert
Willen
und
Ausdauer.
Die
Wanderstöcke
kommen
zum
Einsatz,
geben
Sicherheit
beim
Gehen.
Ich
bin
stolz
auf
Brigitte,
sie
hat
diese
Strapaze
und
den
ebenso
kräftezehrenden
Abstieg
durchgehalten.
Lediglich
ihren
Rucksack
trägt
John
zu
ihrer
Erleichterung.
Joachim
fängt
auf
halber
Höhe
an
zu
schwächeln,
er
übergibt
sich,
wird
von
Imani
und
Dixon
beim
Gehen
unterstützt.
Über
einen
Geröllweg
geht
es
sehr
langsam
bis
zum
Stella-Point
in
5.750 m
Höhe.
Der
Name
bewahrt
das
Andenken
an
Estella
Latham,
einer
südafrikanischen
Bergsteigerin,
die
gemeinsam
mit
ihrem
Mann,
Kingsley
Latham,
am
13.07.1925
hier
den
Kraterrand
erreicht
haben.
Am
Punkt,
nach
etwa
sechs
Stunden
angekommen,
erleben
die
Bergsteiger
einen
faszinierenden
Sonnenaufgang.
Im
Osten
flammt
über
einer
schnurgeraden
Wolkenlinie
van
Goghs
Sonnengelb
auf
und
verglüht
im
brennenden
Rot.
Der
Rebmann-Gletscher
liegt
auf
der
linken
Seite
im
Morgenlicht.
Auf
Fotos
muss
ich
verzichten,
die
Kraft
und
die
erforderliche
Zeit
den
Apparat
auszupacken,
sind
nicht
gegeben.
Eine
kurze
Rast,
ein
Becher
Tee,
dann
werden
wieder
die
Rucksäcke
geschultert.
Weitere
165
Höhenmeter
schleppen
wir
uns
bergauf,
bis
der
Gipfel
zu
sehen
ist.
Unter
der
Schädeldecke
knackt
es
im
Takt
der
Schritte.
Hechelndes
Atmen.
Der
Rachen
schmerzt,
ein
leichtes
Schwindelgefühl
ist
zu
spüren.
Ich
laufe
neben
mir
her,
bin
mein
Schatten,
habe
nichts
mehr
mit
dem
Mann
zu
tun,
der
da
geht.
Nur
langsam
kehre
ich
zu
mir
zurück.
Ein
überwältigendes
Gefühl,
das
Brigitte und mir die Tränen in die Augen treibt.
Endlich
ist
es
geschafft.
Wenige
Meter
vor
dem
Gipfel
greift
Imani
die
Hände
von
Brigitte
und
mir
und
geht
mit
uns
gemeinsam
zum
höchsten
Punkt
Afrikas.
Sein
spaßiger
Kommentar:
„
Jetzt
geht
der
Enkel
mit
seinen
Großeltern
zum
Gipfel
“.
Es
ist
7:00
Uhr,
alle
Anstrengungen
fallen
von
einem
ab.
Brigitte
und
ich
stehen
auf
dem
Uhuru
Peak,
der
Freiheitsspitze,
in
5.895
Metern
Höhe.
Eine
Höhe,
die
über
dem
Mount
Blanc,
dem
höchsten
Berg
der
Alpen
liegt
(4.808
m).
Joachim
erreicht,
dank
seiner
Helfer,
wenig
später
den
Gipfel.
Auf
drei
übereinandergenagelten
Holzbrettern
ist
in
gelber
Kerbschrift folgende Botschaft zu lesen:
Unter
dem
Schild
steht
ein
Blechkasten.
Sein
Inhalt
ist
eine
Bronzetafel
mit
den
Worten
aus
der
Unabhängigkeitserklärung
Tansanias.
Neben
dem
Kasten
steht
ein
verwirrter
Mensch:
Das
bin
ich.
Es
dauert
ein
wenig,
bis
ich
begreife,
dass
wir
wirklich
am
Ziel
sind. Unglaublich, was das Leben manchmal zu bieten hat.
Der
Gipfel
ist
flach,
kein
herausragender
Punkt,
nur
Geröll
bis
zum
Kraterrand
hin.
Würde
hier
nicht
das
verwitterte
Schild
stehen,
man
würde
es
nicht
merken,
dass
man
auf
dem
Gipfel
angekommen
ist.
Trotz
aller
Widrigkeiten
ist
es
eine
beeindruckende
Landschaft.
Wind
und
Wolken
sind
die
einzigen
bewegten
Elemente,
der
Himmel
ist
groß,
der
Blick
geht
weit.
Die
Luft
ist
klar
und
trocken.
Keine
Fliege
schwirrt.
In
den
nächsten
Minuten
genießen
wir
trotz
der
Kälte
von
-7 °C
den
fantastischen
Rundblick
zum
Mawenzi,
zum
Mount
Meru,
zu
den
Eisfeldern
und
in
den
riesigen
Krater
des
Kibo.
John
schießt
einige
Gipfelfotos
von
uns,
ich
fotografiere
nach
allen
Seiten,
was
die
Zeit
hergibt.
Der
eigentliche
Kibokrater
liegt
weiter
im
Norden,
annähernd
in
der
Mitte
des
Kraterkessels,
der
Caldera,
deren
Durchmesser
etwa
zwei
Kilometer
beträgt.
Von
unserem
Standpunkt
aus
kann
man
nicht
in
seine
Öffnung
hineinsehen.
Der
Krater
ist
benannt
nach
dem
Missionar
Richard
Reusch,
der
diesen
Schlund
am
Gipfel
1927
entdeckte.
Irgendeine
warnende
Botschaft
lauert
hinter
jedem
Bild,
das
ich
aufnehme.
Wenn
auch
die
Elemente
friedfertig
vereint
erscheinen:
Das
Feuer
im
Berginneren
lässt
sich
erahnen,
obwohl
die
vulkanischen
Dampfquellen,
die
Fumarolen,
und
die
schwefelhaltigen
Heißdämpfe,
die
Solfataren,
im
Krater
unsichtbar
bleiben.
Das
Wasser
tritt
in
Form
blaugrüner
Gletscher
auf,
die
Erde
als
schwarzbrauner
Lavaguss
und
die
Luft
in
einem
unvergleichlichen
Blau.
Gipfelwüste
–
Eiszeit
–
die
Grenze
des
Wachstums.
Der
Blick
zu
den
Gletschern
fasziniert
mich.
Gefrorene
Lachen
am
Gletscherfuß,
riesige
Eiszapfen
und
tiefe
Höhlungen,
Brandungskehlen
gleichend,
zeigen
auch
hier
den
Verfall.
Es
sind
uralte
Giganten,
die
hier
langsam
sterben.
Heute
nimmt
man
an,
dass
die
letzten
Gletscher,
eigentlich
sind
es
ja
nur
noch
Toteisblöcke
auf
dem
Dachfirst
Afrikas,
2020
verschwunden
sein
werden.
Mein
lieber
Lenzi,
ich
denke
an
Dich,
noch könntest Du die Eispackungen mit eigenen Augen sehen!
Das
Ende
der
Gletscher
gibt
den
Adjektiven
unbewohnbar,
unaufhaltsam,
unwiederbringlich,
eine
lehrreiche
tiefe
Bedeutung.
Ausgebrannt
erscheint
hier
alles.
Die
Landschaft
ist
ohne
Leidenschaft,
aber
auch
ohne
Hoffnung.
Sie
liegt
im
grellen
Licht,
atmet
nicht
und
brütet
doch
lautlos
etwas
aus.
Die
Welt
bleibt
hier
oben
stehen
und
ich
denke
einen
Moment
über
das
Leben
nach:
Es
ist
schön
und
kostbar,
dieses
Leben,
besonders
dann,
wenn
man
es
sich
selbst
gestalten
kann.
Ich
versuche
mich
zu
orientieren,
schaue
ins
Rund.
Westwärts
liegen
der
Furtwänglergletscher
und
das
Nördliche
Eisfeld.
Der
Blick
richtet
sich
auf
den
Mawenzi,
auf
eine
Vielzahl
von
Türmen,
Zinnen,
Spitzen
und
Nadeln,
die
seine
im
Westen
mehr
als
600
Meter
hohe
Hauptwand
überragen.
Er
ist
ein
bizarrer,
schöner
Berg
und
immerhin
der
Dritthöchste
in
Afrika.
Durch
sein
brüchiges
Gestein
hat
er
auch
den
Beinamen
Totschläger
erhalten.
In
der
Chaggasprache
wird
er
Kimawenzi
genannt,
was
soviel
wie
der
Gezackte
bedeutet.
Das
Panorama
am
Kraterrand
raubt
einem
den
letzten
Rest
Atem.
Sicherlich
war
das
auch
die
Ursache,
dass
bei
mir
kurzzeitig
eine
Gleichgewichtsstörung
auftritt,
als
ich
von
der
Gehrichtung
abdrifte.
Noch
schnell
werden
einige
Fotos
von
den
Eisfeldern
aufgenommen,
dann
zwingt
uns
John
zum
Abstieg.
Ein
freundlicher
junger
Mann
aus
dem
Schweizer
Team
schiebt
mir
einen
Kaubonbon
in
den
Mund,
denn
er
hat
meinen
torkelnden
Gang
bemerkt.
Nach
einer
viertel
Stunde
ist
die
Gipfelzeit
abgelaufen.
Es
wimmelt
mittlerweile
von
Rotjacken.
Ein
letzter
Blick
zum
Rebmann
Gletscher.
Oder
besser,
das
Häuflein,
das
davon
übrig
geblieben
ist.
Früher
erstreckte
er
sich
über
die
ganze
Flanke.
Stattdessen
liegt
dort
nur
das
Wrack
eines
Gletschers,
am
schwarzen
Lavastrand
gescheitertes
Eis,
etwas
traurig
anzusehen.
Seine
Formen
wirken
zerstört:
ein
lieblos
gestürzter,
vielleicht
noch
ein
Dutzend
Meter
hoher
Formpudding
aus
rosa
Eis
und
Schnee.
Kaum
vorstellbar,
dass
die
Gletscher
des
Kibogipfels
einmal
bis
in
den
Krater
hineinreichten
und
aus
glashartem,
blauem
Eis
bestanden.
Die
ersten
Gipfelbezwinger,
Hans
Meyer
und
seine
Begleiter,
schlugen
im
Jahr
1889
noch
mühsam
Stufen
in
das
Eis,
um
zum
Gipfel
zu
gelangen.
Ohne
Pause
geht
es
auf
einen
unglaublichen
Schotterweg
bergab.
Wo
das
Sonnenlicht
hinfällt,
wechselt
der
schwarze
Boden
seine
Färbung
hin
zu
goldenem
Braun.
Die
Sonne
heizt
tüchtig
ein,
die
dicke
Kleidung,
die
vor
der
Nachtkälte
geschützt
hat,
besorgt
den
Rest.
Trittsicherheit
ist
im
Schotterfeld
nicht
gegeben,
dafür
rutschen
die
Zehen
schmerzhaft
an
die
Schuhspitzen.
Das
Resultat
ist
später
nicht
nur
spürbar,
sondern
auch
sichtbar.
John,
Brigitte
und
ich
bilden
die
Nachhut,
denn
Joachim
begleitet
von
den
anderen
Guides,
muss
schneller
von
der
Höhe
runter.
Am
Barafu
Camp
nach
fünf
Abstiegsstunden,
um
10:30
Uhr
angekommen,
werden
wir
von
unseren
Trägern
herzlich
mit
einem
kühlen
Getränk
begrüßt
und
beglückwünscht.
Joachim
liegt
im
Zelt
und
ruht.
Der
Zwischenaufenthalt
im
Camp
ist
zeitlich
begrenzt,
denn
es
muss
noch
weiter
bergab
gehen.
Nach
kurzer
Rast
wird
ein
Teil
der
Kleidung
gewechselt,
der
Rest
wandert
in
die
Packsäcke.
Eine
heiße
Suppe
und
eine
Gemüsepfanne
geben
verbrauchte
Kraft
zurück.
Ab
12:00
Uhr
heißt
es
erneut
Aufbruch.
Weitere
5
Stunden
geht
es
nun
bis
auf
3.080
Meter
hinab.
Am
Kilimanjaro
herrscht
eine
strenge
Einbahnregelung
bezüglich
der
vorhandenen
Routen.
Im
Barafu
Camp
gibt
es
weder
Wasser
noch
genügend
Platz
für
nachrückende
Gipfelstürmer
–
also
muss
die
Gruppe,
die
oben
war,
schnell
weit
hinunter.
Für
den
Abstieg
ist
der
Mweka
Trail
vorgesehen.
Mit
blutunterlaufenen
Zehen
geht
es
Schritt
für
Schritt
über
das
abfallende
Gelände.
Eine
große
Wasserblase
macht
mir
darüber
hinaus
das
Gehen
zur
Qual.
Nach
etwa
zwei
Stunden
wird
die
Landschaft
belebter.
Wind
fegt
über
das
Terrain.
Die
ersten
Grasbüschel
und
graugrüne
Staudengewächse
stehen
im
Geröll.
Am
Fuß
der
Geländestufe
fällt
auf,
dass
die
Wanderer
in
einer
anderen
Vegetationsstufe
angelangt
sind.
Strohblumen
und
die
vertrauten
Rosetten
von
Lobelien
und
Senecien
–
die
einen
ähneln
Artischocken,
die
anderen
Kohlblättern
–
stehen
zwischen
den
Scheinzypressen.
Der
Bewuchs
ist
wesentlich
dichter
als
in
den
windigen
Höhen,
woher
wir
vor
Stunden
gekommen
sind.
Vor
allem
erscheinen
erstmals
wieder
Baumheiden,
diesmal
mit
nadelartigen
Blättern
und
dann
wieder
die
vom
Aufstieg
her
vertrauten
Erica-Bäume.
Die
Pflanzen
der
Baumheide
ähneln
den
Bruyèresträuchern,
aus
dem
die
Pfeifen
hergestellt
werden,
die
ich
einst
genüsslich
schmauchte.
Bemerkenswert
sind
auch
riesige,
orangerote
Flechtennetze,
die
in
solchen
Mengen
nirgends
sonst
am
Kilimanjaro
vorkommen.
Im
Millennium
Camp
wird
eine
Tee-Pause
eingelegt,
dann
geht
es
munter
weiter.
Der
Weg
wird
abschnittsweise
schwierig
–
immer
steiler,
immer
tiefer
-
nur
der
Ausblick
auf
die
Landschaft
entschädigt
für
die
Strapazen
des
Weges.
Aufgrund
des
starken
Gefälles
geht
es
trotz
schmerzender
Zehen
zügig
bergab
zum
Mweka
Camp.
Um
17:00
Uhr
ist
das
Tagesziel
erreicht.
2.800
Höhenmeter
liegen
hinter
uns.
Der
Körper
fordert
Ruhe.
Das
letzte
Lager
befindet
sich
in
einem
schönen
Erika-Baumwald.
Der
Eintrag
ins
Camp-Buch
ist
Routine.
Unser
Traumberg
liegt
nun
abseits
in
grauviolettem
Zwielicht.
Eine
dunkle
Wolkenschleppe
zieht
über
den
Gipfel.
Die
Gletscher
blitzen
nochmals
in
der
Sonne,
bevor
sie
versinkt.
Es
ist
sieben
Uhr
abends.
Die
Sonne
ist
mit
uns
aus
dem
Zenit
abgestiegen.
Knapp
17
Wanderstunden
stecken
in
den
Beinen.
Die
Abgekämpften
löffeln
schweigsam
Suppe,
ziehen
Jacken
und
Schuhe
aus
und
kriechen
nach
einer
Katzenwäsche
erschöpft
in
die
Schlafsäcke.
Die
übergroße
Müdigkeit
lässt
alle
anderen
Gefühle
schweigen.
Über
die
Mühen
des
Abstiegs
schreibe
ich
nicht
viel
auf,
kritzele
nur
einige
Notizen
in
mein
Büchlein.
Ein
Foto
mit
allen
Helfern
zeigt
erschöpfte
aber fröhliche Menschen – das Ende naht.


Im Reisetagebuch geblättert
(Montag, 16.08.2010)
The Roof of Afrika


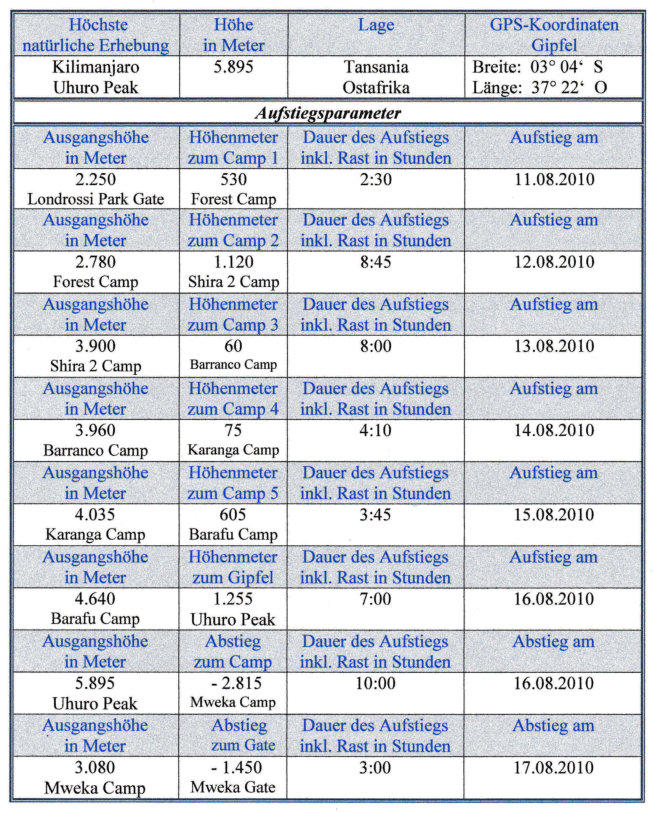


1. Etappe






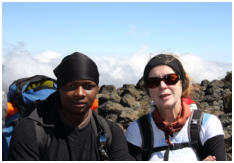


2. Etappe
3. Etappe












4. Etappe
5. Etappe






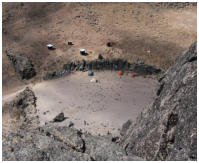

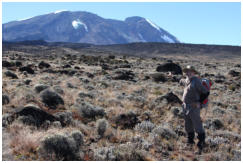

6. Etappe










7. Etappe






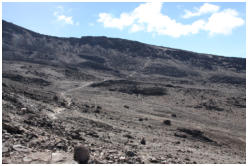

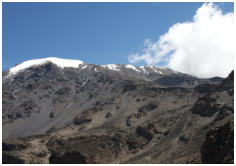






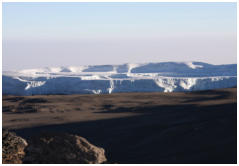













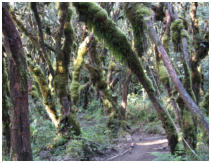









im Kontext der Geschichte